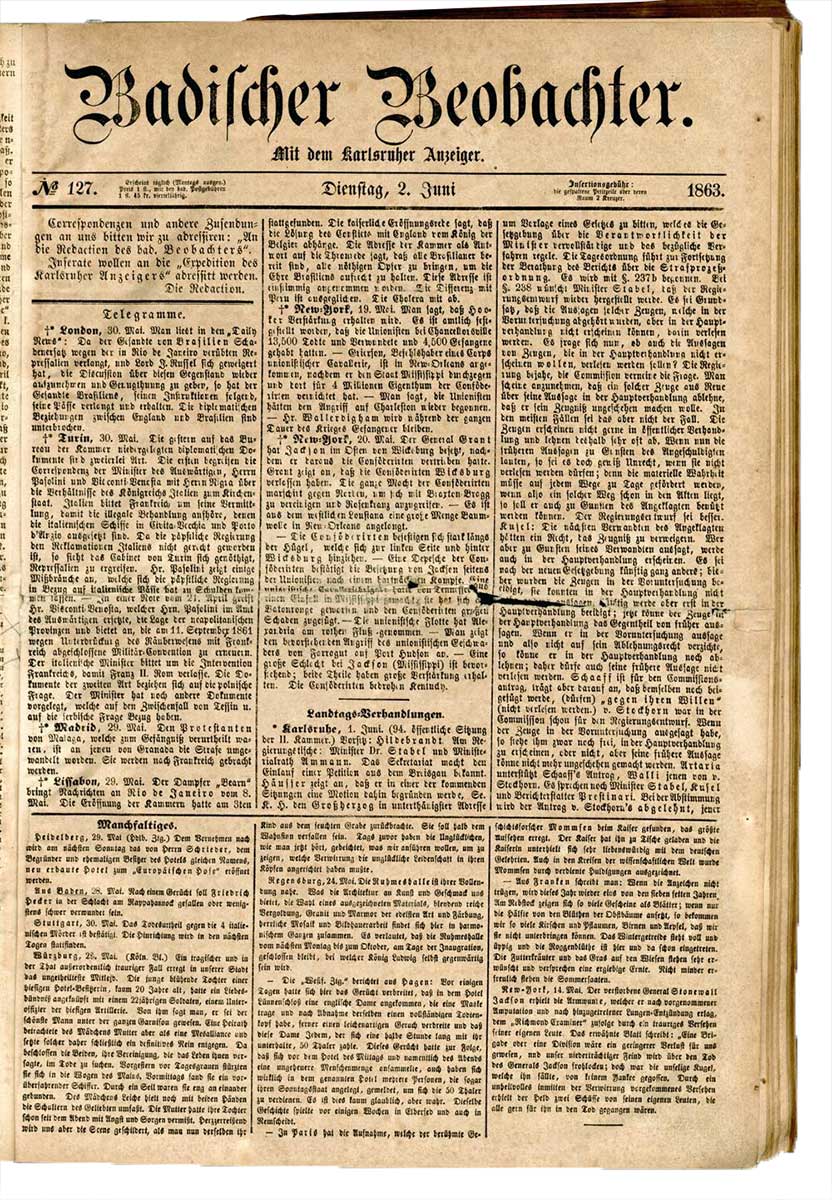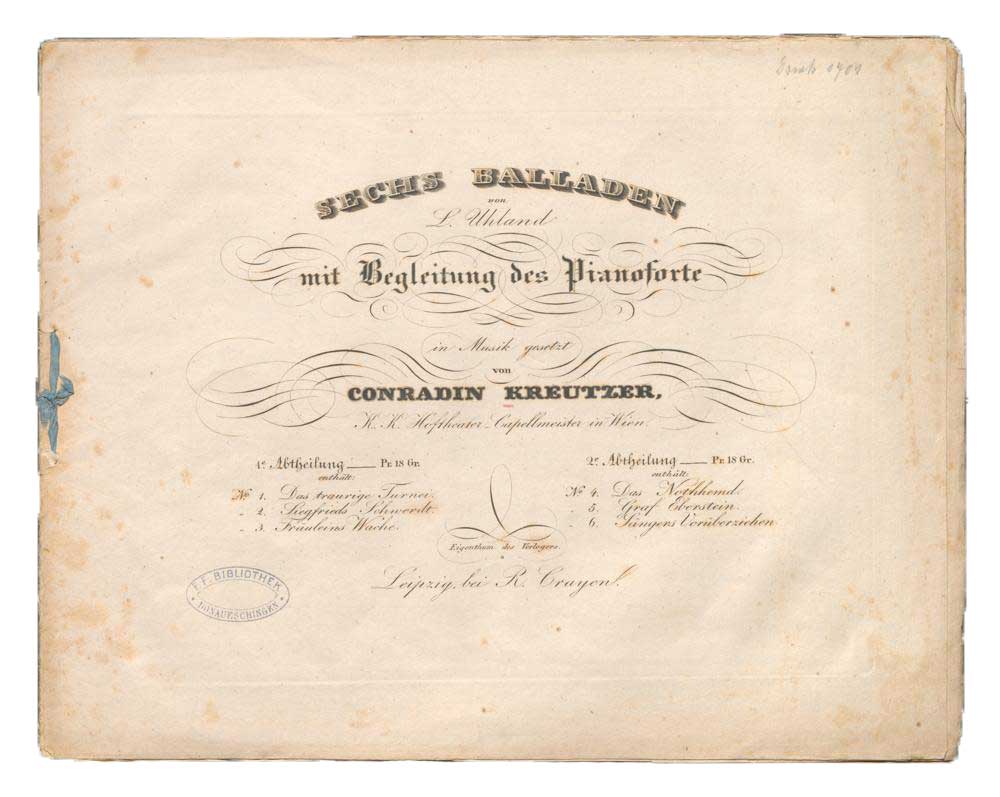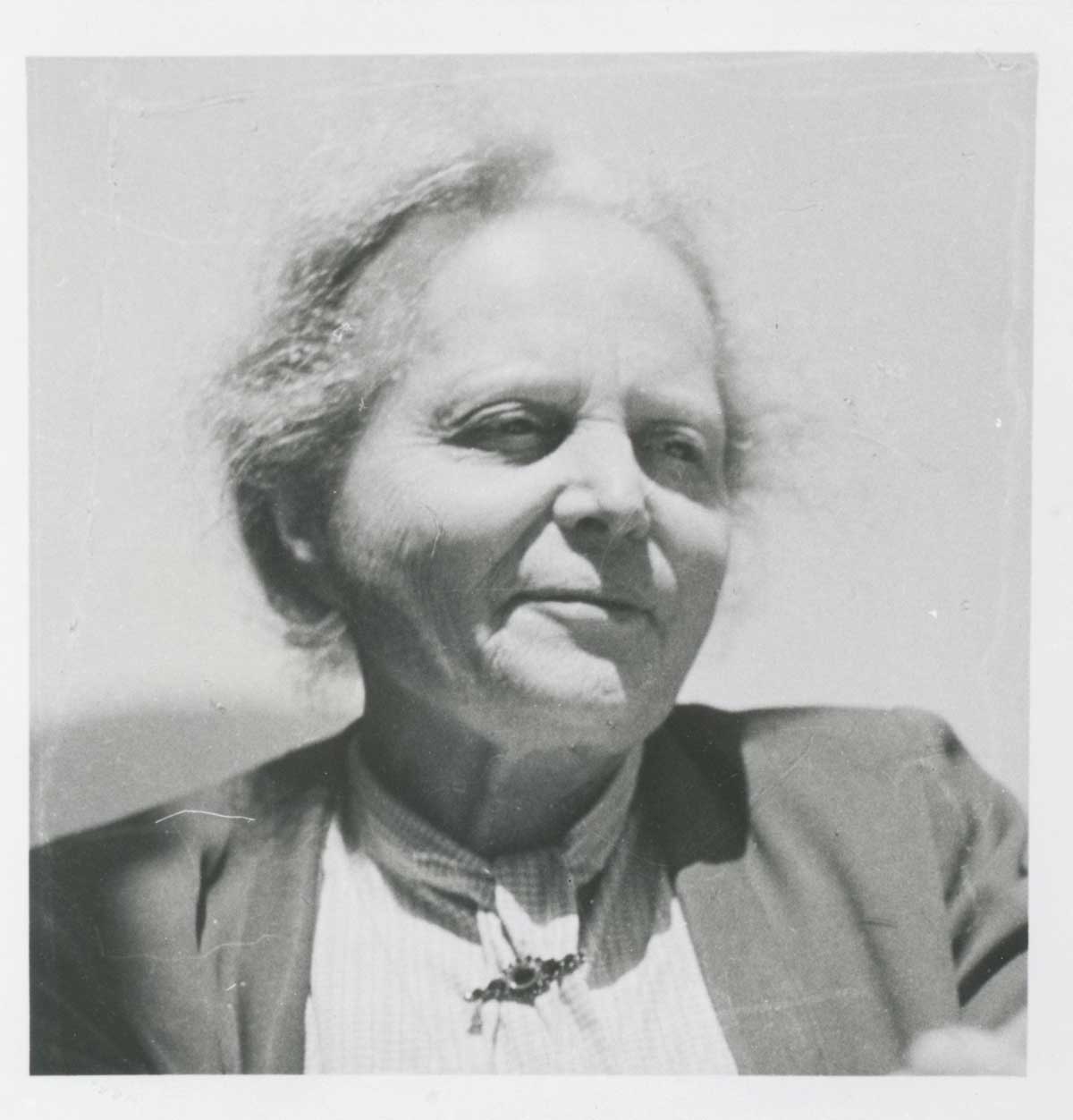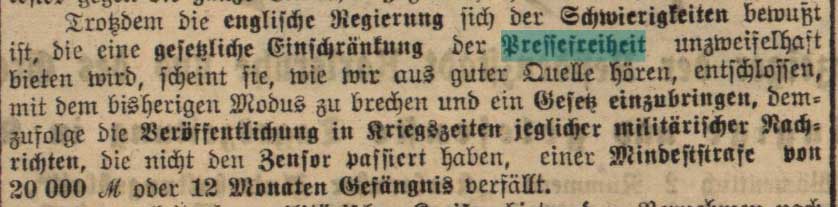Herzlich Willkommen im BLBlog!
Hier finden Sie verschiedene Beiträge aus unseren breit gefächerten Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern: Interessantes, Wissenswertes, Kurioses und sicherlich die ein oder andere Überraschung aus dem Alltag der Badischen Landesbibliothek. Auch Themen, von denen die BLB als Institution betroffen ist, werden aufgegriffen, kommuniziert und kommentiert.
Recherchieren und arbeiten Sie zu Beständen der Badischen Landesbibliothek? Haben Sie einen interessanten Artikel, den Sie uns vorschlagen möchten? Wir freuen uns über Ihre Nachrichten, Anmerkungen und Fragen zu den Blogbeiträgen.
Kontakt: Dr. Michael Fischer
ISSN 2751-9031
- <<
- <
- 1
- >
- >>